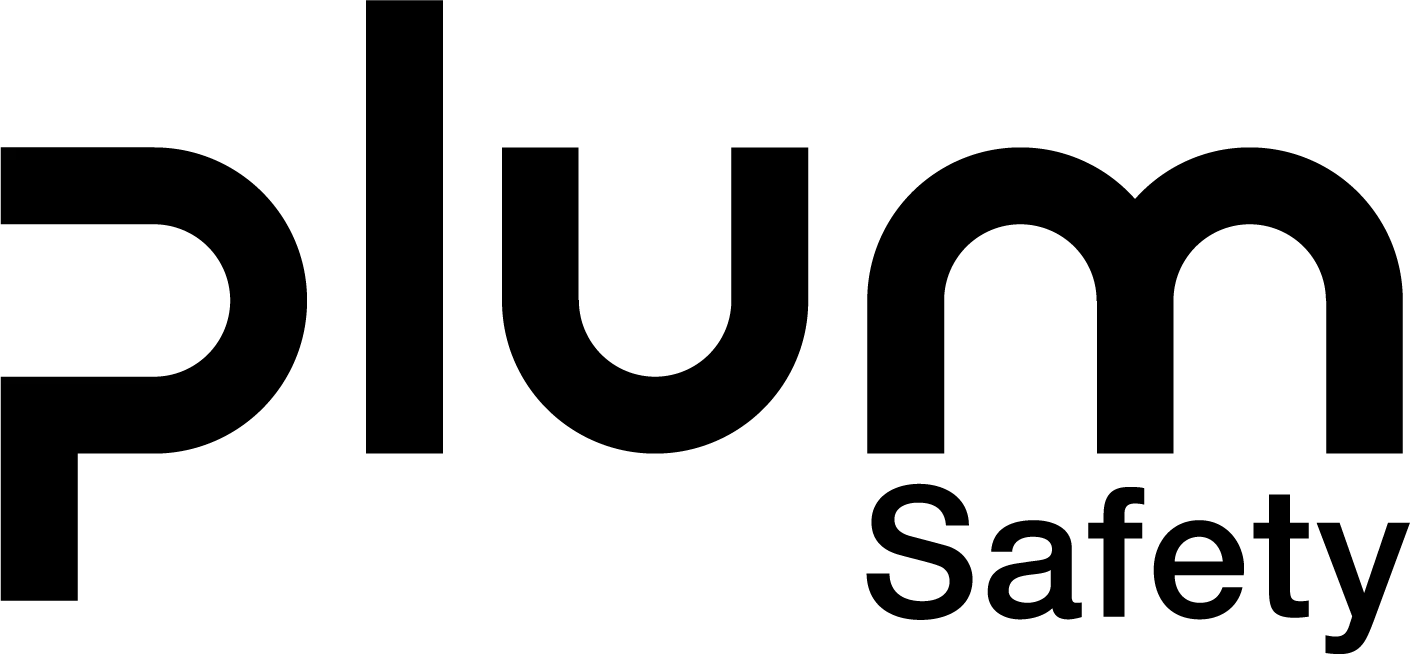KOMPASS SAFETY CHECK
Ihr persönliches Sicherheitskonzept PSA-Komplettlösung Arbeitsplatz-Analyse Minimierung der Ausfallzeiten Reduzierung der Kosten Einhaltung der Dokumentationspflicht

KOMPASS SAFETY RENT
Ihr persönlicher Mietservice für Ihren Arbeitsschutz • Atemschutz, PSA gegen Absturz und Textilien • kostenoptimierter Einsatz im Bedarfsfall • nachhaltige Bearbeitung • Fachgerechte, hygienische Aufbereitung

SERVICE-TOOL MEINE WARTUNG
Wartungssicherheit auf einen Klick • Vorbeugende Instandhaltung aller Prüfgegenstände • Individuell angelegte Produktdatenbank • Dauerhaft sicherer Betrieb

Gebläseatemschutz Cleancpace
Zertifiziertes Überdruck-Atemschutzgerät • Ultra Power System zur Miete • fachgerechte Bereitstellung • maximaler Schutz • IP Schutzart 66 • Filtrationsleistung P3 TM3
GUT INVESTIERT IN
ARBEITSSCHUTZ
GUT
BERATEN
Die KOMPASS-Experten
GROSSE
AUSWAHL
Die KOMPASS-Produktwelt
SICHERER
EINKAUF
Faire Konditionen und bewährte Konzepte
SCHNELLE
LIEFERUNG
24h-Service und klimaneutraler Versand
Finden Sie den passenden Händler in Ihrer Nähe.
Rechtsgrundlagen für den Arbeitsschutz
Rechtsgrundlagen für den Arbeitsschutz
Eine Zusammenfassung der wichtigsten Informationen zu den Arbeitsschutzpflichten, die sich aus dem Arbeitsschutzgesetz (ArbschG) ergeben sowie Details aus der PSA-Benutzungsverordnung (PSA-BV) und der Verordnung für Persönliche Schutzausrüstung PSA-V EU 2016/425 finden Sie hier:
Mehr erfahren


03/2025
„Pan“ verspricht mehr Fußfreiheit in Industrie und Handwerk

10/2024
Kübler erweitert Weather-Workwear

09/2024
Der erste zertifizierte Barfuß-Sicherheitsschuh der Welt

09/2024
ATG® Nachhaltigkeit - Mangroven-Anbau 2024

06/2024
Textilleasing – John Glet erweitert den Vertrieb

05/2024
Kübler Reflectiq für Damen

04/2024
3M™ Secure Click™ Halbmasken
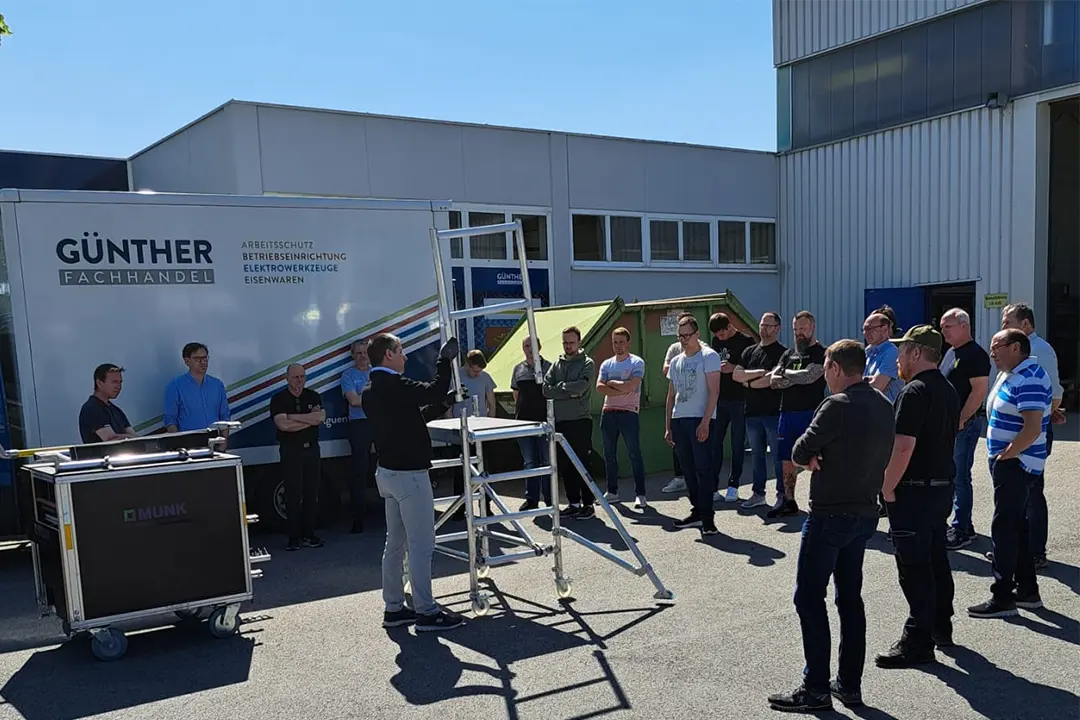
06/2023
Seminar zur Prüfung befähigter Person für Leitern, Tritte, Klein- und Fahrgerüste.

05/2023
Der neue Industrieschutzhelm 9500 - HEAD PROTECT von NITRAS

04/2023
Rezertifizierung "Zertifizierter Fachbetrieb für PSA nach VTH-Standard"

02/2023
Carhartt – Neu im Sortiment bei Günther Fachhandel in Bad Neustadt!

02/2023